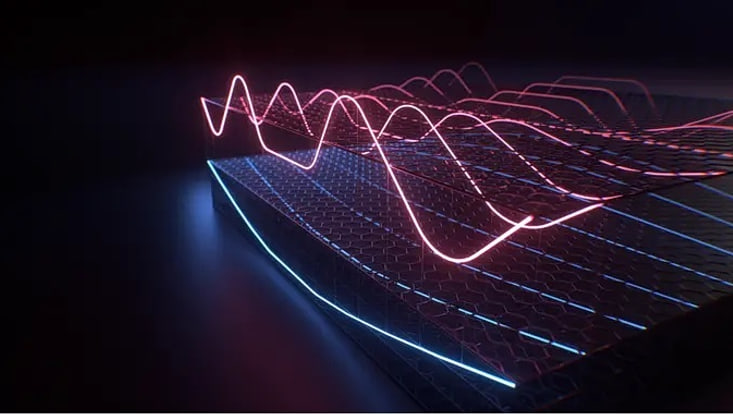Imaging of Matter
Elektronen in Bewegung
25. Februar 2020

Foto: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Einem internationalen Forscherteam mit Beteiligung von DESY ist es gelungen, ultraschnelle Quanteninterferenzen von Elektronen in der Atomhülle von Edelgasatomen in Echtzeit zu beobachten. Das Team um Frank Stienkemeier und Lukas Bruder von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg konnte elektronische Schwingungen mit einer Periodendauer von nur etwa 150 Attosekunden aufzeichnen. Eine Attosekunde ist der milliardste Teil einer milliardstel Sekunde. Für die im Fachblatt „Nature Communications“ veröffentlichte Studie wurden Edelgasatome mit eigens präparierten Laserpulsen angeregt und die Reaktion der Atome mit einer neuen, hochempfindlichen Messmethode verfolgt. Das Verfahren ermöglicht die Beobachtung fundamentaler quantenmechanischer Effekte in Atomen und Molekülen auf ihrer natürlichen Zeitskala.
Viele chemische Reaktionen werden durch die Bestrahlung von Materie mit Licht eingeleitet, beispielsweise Bindungsbrüche in Molekülen. Im ersten Moment nach der Absorption des Lichts verändert sich die Struktur der Elektronen in der Atomhülle, was den weiteren Verlauf der Reaktion maßgeblich beeinflusst. Diese Veränderung läuft sehr schnell ab und kann mitunter nur einige wenige Attosekunden umfassen. Konventionelle Spektroskopie-Techniken, die sichtbare Laserpulse verwenden, sind nicht schnell genug, um solche Prozesse verfolgen zu können. Deshalb werden weltweit neuartige Laserquellen und entsprechende Spektroskopie-Techniken im extrem-ultravioletten oder im Röntgenbereich entwickelt.
Neue Technik ermöglicht direkte Beobachtung
Dem Forschungsteam ist es nun mit einer neuen Technik gelungen, Quanteninterferenzen in der Atomhülle – eine Art Schwingungsmuster der Elektronen – direkt auf ihrer natürlichen Zeitskala zu beobachten. Hierbei wurde die bereits aus dem sichtbaren Spektralbereich bekannte Technik der kohärenten Pump-Probe Spektroskopie auf den extrem-ultraviolett (XUV) Bereich erweitert, den Spektralbereich zwischen Röntgenstrahlung und ultraviolettem Licht: Eine Sequenz bestehend aus zwei ultrakurzen XUV-Laserpulsen wurde am Freie-Elektronen-Laser FERMI in Triest (Italien) nach dem in Freiburg entwickeltem Verfahren präpariert. Beide Pulse haben dabei einen genau bestimmten zeitlichen Abstand sowie eine genau definierte Phasenbeziehung zueinander. Die Phase bezeichnet den Zustand, in dem sich eine Schwingung (beispielsweise eine Lichtwelle) zu einem vorgegebenen Zeitpunkt befindet.
Der erste Puls startete den Prozess in der Elektronenhülle (Pump-Prozess), der zweite Puls diente als Abfrage über den Zustand der Elektronenhülle zu einem späteren Zeitpunkt (Probe-Prozess). Durch gezielte Veränderung von zeitlichem Abstand und der Phasenbeziehung können Rückschlüsse über die zeitliche Entwicklung in der Elektronenhülle gezogen werden. „Die größte Herausforderung war es, eine möglichst präzise Kontrolle über die Eigenschaften der Pulssequenz zu erlangen und die schwachen Signale messtechnisch zu isolieren“, erklärt der Freiburger Doktorand Andreas Wituschek, der maßgeblich für die experimentelle Durchführung verantwortlich war.
Hervorragende ultrakurze Lichtblitze
„Insbesondere die hervorragenden Kohärenzeigenschaften der ultrakurzen Lichtblitze, welche im sogenannten Seeding-Verfahren bei FERMI erzeugt werden, sind für die Experimente von entscheidender Bedeutung“, betont DESY-Wissenschaftler Tim Laarmann, einer der Mitautoren der Studie, der auch im Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“ forscht. Im Rahmen des Ausbauprojekts FLASH2020+ soll diese besondere Strahlqualität auch Forscherinnen und Forschern an DESYs Freie-Elektronen-Laser FLASH mit deutlich höherer Repetitionsrate zur Verfügung gestellt werden.
Als Beispiel wurde Argon untersucht, bei dem der Pump-Puls eine spezielle Konfiguration zweier Elektronen innerhalb der Atomhülle erzeugt. Diese Konfiguration zerfällt, indem ein Elektron das Atom innerhalb einer sehr kurzen Zeit verlässt, und schlussendlich das Atom als Ion zurückbleibt. Dem Team gelang es zum ersten Mal, den direkten zeitlichen Zerfall der Quanteninterferenzen zu beobachten, während das eine Elektron das Atom verlässt. „Dieses Experiment bereitet den Weg für viele neue Anwendungen in der Untersuchung von atomaren und molekularen Prozessen nach gezielter Anregung mit hochenergetischen kohärenten Lichtfeldern“, ergänzt Lukas Bruder.
Beteiligt an dem Forschungsprojekt, welches unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Verbundforschung zum Thema „Longitudinale Kohärenz am Freie-Elektronen-Laser - Kontrolle, Analyse und Anwendungen (LoKoFEL)“ gefördert wurde, waren die Universität Freiburg, die Universität Lund, das Elettra-Synchrotron Trieste, IFN-CNR und das Politecnico di Milano in Italien, die Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne in der Schweiz, die Universität Göteborg in Schweden, DESY, CUI, die Universität Aarhus in Dänemark, die Universität Mailand und die La-Sapienza-Universität Rom in Italien sowie das Freiburg Institute of Advanced Studies der Universität Freiburg. Text: DESY, red.
Originalveröffentlichung:
A. Wituschek et al.
"Tracking attosecond electronic coherences using phase-manipulated XUV pulses"
Nature Communications (2020)