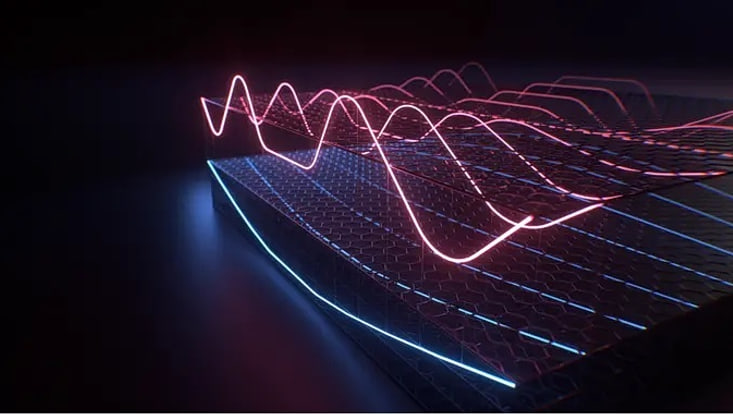Imaging of Matter
Coronavirus-Proteine im Röntgenblick
2. April 2020
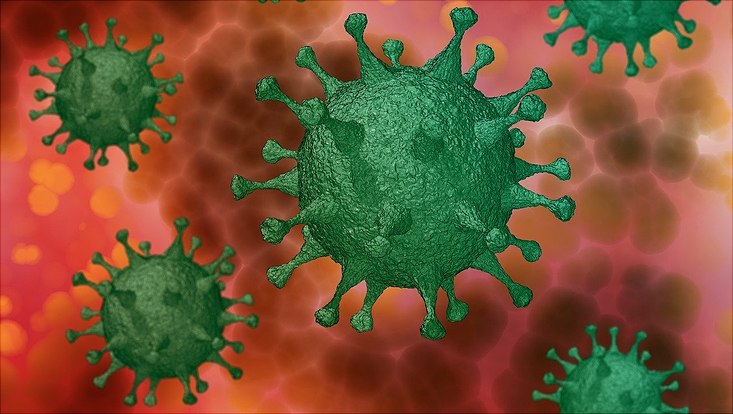
Foto: Pete Linforth/Pixabay
Weltweit suchen Forschungsgruppen intensiv nach Ansatzpunkten für Wirkstoffe gegen SARS-CoV-2, wie das Coronavirus von der Weltgesundheitsorganisation WHO getauft wurde. Auch Hamburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bringen ihre Expertise ein, um die Erforschung des neuartigen Virus gemeinsam voranzutreiben. Auf dem Campus in Bahrenfeld beginnt jetzt eine Versuchsreihe, die zwei Schlüsselproteine des Erregers und zwei menschliche Proteine, welche die Aufnahme des Erregers in Lungenzellen ermöglichen, unter die Lupe nimmt. Hat die Untersuchung Erfolg, könnte sie die Suche nach einem Medikament erheblich verkürzen.
Unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Christian Betzel und Prof. Arwen Pearson von der Universität Hamburg und dem Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“ und Dr. Alke Meents von DESY untersucht die Studie mehrere tausend bereits existierende Wirkstoffe darauf, ob sie auch gegen das neue Coronavirus helfen. Das Verfahren ist kompliziert und erfordert die Expertise verschiedener Bereiche: Allein vom Exzellencluster bringen Prof. Henry Chapman, der auch leitender Wissenschaftler bei DESY ist, Prof. Henning Tidow und Prof. Tobias Beck ihr Know-how in den Bereichen Röntgenkristallographie, Proteindesign und Strukturbiologie ein. „Über die komplementäre und exzellente Expertise der beteiligten Arbeitsgruppen konnten wir innerhalb sehr kurzer Zeit eine sehr effektive Task-Force zusammenstellen mit der wir nun sehr effektiv und erfolgsversprechend die Wirkstoffsuche beginnen. Das gebündelte Know-how der beteiligten Gruppen auf dem DESY Campus und die Zusammenarbeit bei der Wirkstoffsuche mit Instituten in der Metropolregion ist wahrscheinlich einzigartig. Maßgeblich war und ist natürlich auch die sehr gute Zusammenarbeit und ergebnisorientierte Kommunikation zwischen den beteiligten Arbeitsgruppen“, betont Betzel.
Viren können sich allein nicht vermehren
„Wir haben die ersten Plasmide bekommen, und stellen derzeit Proteine her, die für den Reproduktionsprozess des Virus eine essentielle Rolle spielen“, berichtet DESY-Forscher Alke Meents aus der Forschungsgruppe von CUI-Sprecher Henry Chapman. „Damit werden wir versuchen, Wirkstoffe zu finden, die an diese Proteine binden.“
Viren können sich allein nicht vermehren. Sie kapern dazu Zellen ihres Wirts, schleusen ihr eigenes Erbgut in die Zellen ein und bringen sie so dazu, neue Viren herzustellen. Bei allen diesen Schritten spielen Proteine eine wichtige Rolle. Gelingt es, ein entscheidendes Protein zu blockieren, lässt sich der Zyklus unter Umständen unterbrechen, das Virus kann sich nicht mehr vermehren, und die Infektion ist damit besiegt.
Mit Röntgenlicht die Struktur darstellen
Bei ihrer Suche nach einem solchen Mittel verfolgen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg und von DESY gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Universität Lübeck sowie vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie (IME) den Ansatz der Strukturbiologie: Mit dem hellen Röntgenlicht von DESYs Forschungslichtquelle PETRA III lässt sich die dreidimensionale räumliche Struktur von Proteinen auf 0,1 Nanometer genau darstellen. „Das ist ein zehnmillionstel Millimeter. So eine Auflösung ermöglicht es, die einzelnen Atome des Moleküls zu sehen“, sagt Meents.
Das Team untersucht dabei rund 3700 Wirkstoffe aus dem sogenannten Screening Port des IME daraufhin, ob sie an eines der Proteine binden. „Wenn wir einen Stoff finden, der besonders gut bindet, werden Forscher an der Universität Lübeck im Labor untersuchen, ob er auch die Protein-Aktivität hemmt“, berichtet Meents. In einem dritten Schritt plant das Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, in Zellkulturen zu testen, ob der Stoff die Virusvermehrung hemmt oder gar verhindert.
„In der Datenbank des Screening Ports befinden sich 3700 bereits für die Behandlung von Menschen zugelassene Wirkstoffe oder solche, die sich zur Zeit in verschiedenen Erprobungsphasen befinden“, erläutert Meents. „Sollten wir darunter auf einen geeigneten Kandidaten zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 stoßen, könnten diese erheblich schneller in klinischen Studien eingesetzt werden. Das könnte Monate oder Jahre der Wirkstoffentwicklung sparen.“
Hoffen auf den 'lucky shot'
Wann und ob diese Suche von Erfolg gekrönt sein wird, lässt sich bei derartigen Studien nicht vorhersagen. „Normalerweise ist so ein Projekt auf etwa zwei Jahre angelegt“, berichtet Meents. „Wenn man das mit Nachdruck betreibt, geht es natürlich schneller. Und wenn wir schon am Anfang einen 'lucky shot' haben sollten, könnten wir bereits nach einigen Wochen einen ersten möglichen Wirkstoffkandidaten haben, der dann in Zellkulturen und später in Tiermodellen getestet werden kann. Unsere Experimente stehen ganz am Anfang der Wirkstoffentwicklung, und es ist meistens ein langer Prozess bis zur Entwicklung eines fertigen Medikaments.“ Text: DESY PM/CUI